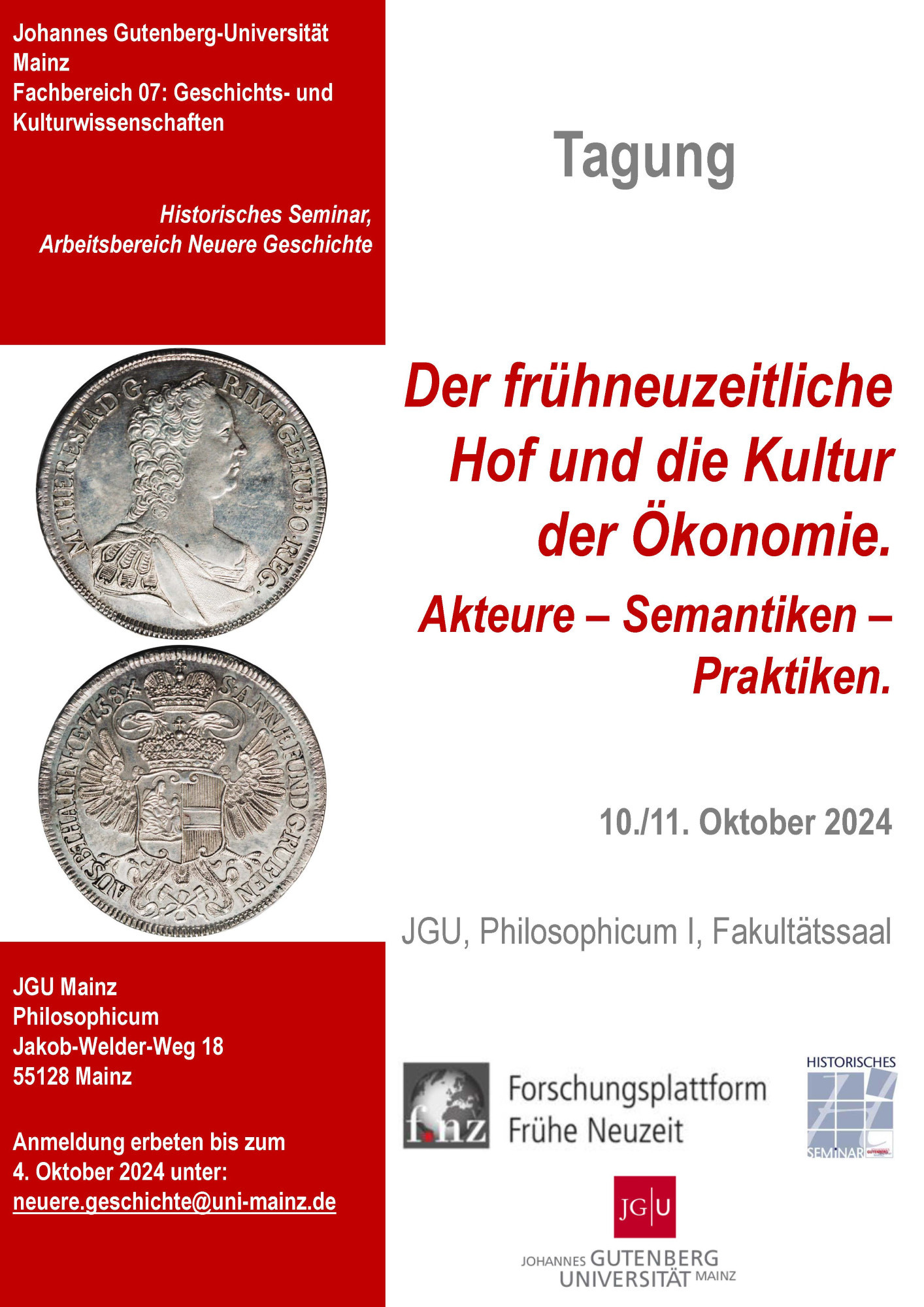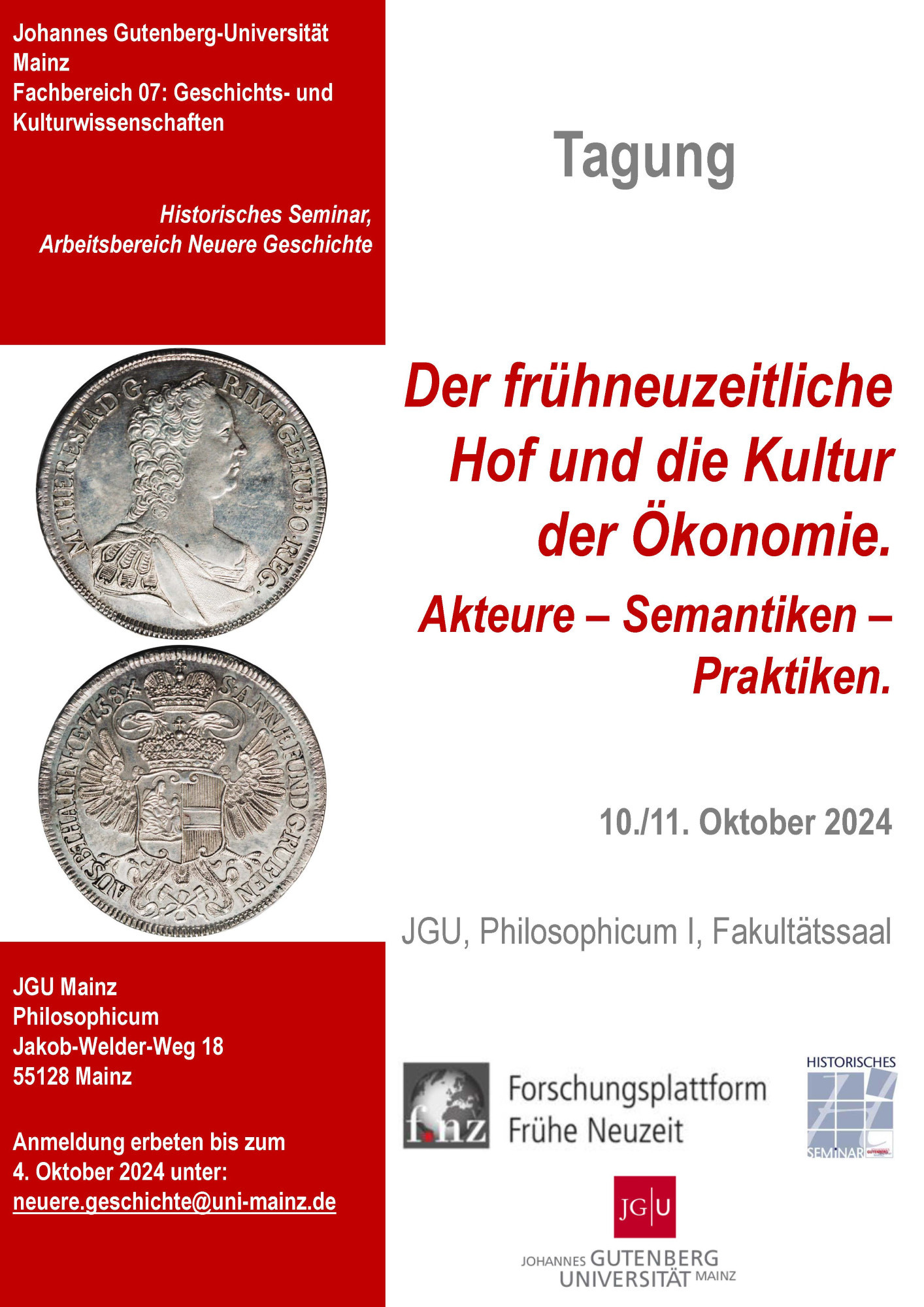Die Tagung möchte Höfe als Schnittpunkte von Politik- und Wirtschaftsgeschichte in den Blick nehmen. Angelehnt an die Ansätze einer "Kulturgeschichte der Wirtschaft" sollen sie als Orte betrachtet werden, an denen ökonomisches Handeln und Entscheiden alltäglich waren. Besonderes Interesse gilt den vielfältigen Akteur:innen, die Ökonomie und Vorstellungen bezüglich derselben beeinflussten, am Hof vorherrschenden Semantiken der Ökonomie sowie Praktiken des Wirtschaftens.
Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte wird die Verknüpfung von Kulturgeschichte und Ökonomie als besonders fruchtbar angesehen, um ökonomische Fragestellungen zu reflektieren. Die Tagung beleuchtet vor allem die Rolle der Höfe als Zentren wirtschaftlicher Aktivitäten, an denen verschiedene gesellschaftliche Gruppen – vom Adel über Diplomaten bis hin zu Unternehmern und Handwerkern – aufeinandertreffen und ökonomische Praktiken prägten. Dabei werden die Höfe als wichtige Akteure in der Aushandlung wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen sowie als Orte des Wissensaustauschs und der politischen Steuerung verstanden.
Konferenzübersicht
Sebastian Becker (Mainz) / Matthias Schnettger (Mainz): Begrüßung und Einführung
Sektion I: Vor und hinter den Kulissen. Akteure und Akteurinnen
Markus Berger (Bamberg), Entrepreneur und Finanzverwalter. Der Kammermeister Hans Harrer und die Wirtschaftspolitik Kurfürst Augusts von Sachsen, 1570-1580
Cathleen Sarti (Oxford), Die dänische Königin als Unternehmerin. Charlotte Amalie von Hessen-Kassel zwischen Hof und Industrie
Molly Taylor-Poleskey (Cambridge, MA), Who gets a Piece of the Pie? Food Servants and the Court Economy of Brandenburg-Prussia
Peter Rauscher (Wien), Kaiserhof und Wiener Kaufmannschaft im frühen 18. Jahrhundert. Ansprüche und Praxis
Sektion II: Reden wir über Wirtschaft. Semantiken des Ökonomischen
Matthias Schnettger (Mainz), „Essendo poi l’Oro, et il Ferro i Cardini del potere..” Wirtschaft und Finanzen in venezianischen Finalrelationen über den Kaiserhof
Guillaum Garner (Lyon), Eine unmögliche Indienstnahme? Hof und Manufaktur in kameralistischer Theorie und in wirtschaftspolitischer Praxis (ca. 1740-ca.1800)
Benjamin Marschke (Halle), Economy at Court. The Case of King Frederick William I of Prussia (1713-1740)
Sektion III: Ökonomie organisiert und reguliert. Höfische Praktiken
Charlotte Backerra (Göttingen/Klagenfurt), Samtrechnung, Hofrechnung, Kammerrechnung. Techniken des ökonomischen Handelns in der frühneuzeitlichen Fürstengesellschaft
Sebastian Becker (Mainz), Technischer Transfer und Ökonomie. Gewerbeförderung in Brandenburg-Preußen
Marian Hefter (Gotha), Umsonst ist der Tod? Zur Ökonomie höfischer Trauerkleidung
Isabel Heide (Erfurt), „Die Herzoglichen Finanzen liegen im Todeskampf […]“. Zur Verwaltung der Privatschatulle des Herzogs August von Sachsen-Gotha und -Altenburg
Schlussdiskussion